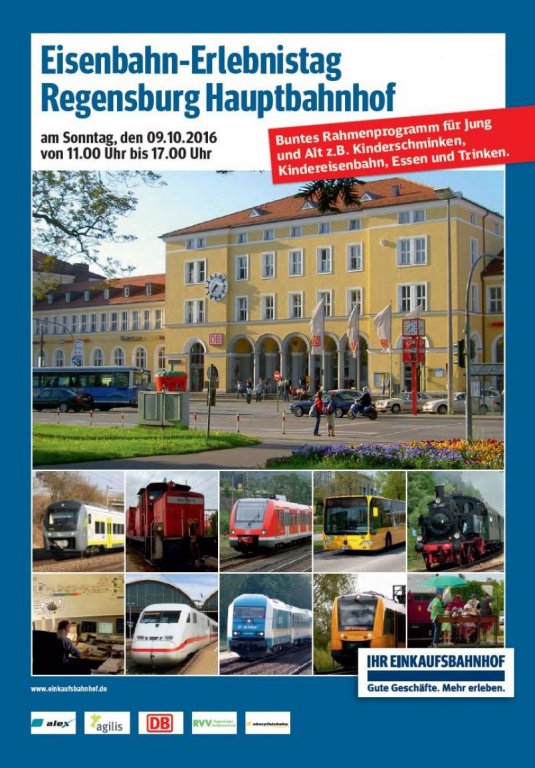Über das historische Ohmwerk (Schiffsdurchzug) an der Steinernen Brücke wollte ich schon lange etwas schreiben. Da ich beim letzten Tag des offenen Denkmals Gelegenheit hatte, ein paar Innen-Fotos zu schießen kann ich den Artikel-Entwurf jetzt abrunden und veröffentlichen.
![]() |
| Besichtigung des Schiffsdurchzugs (Ohmwerk) am Denkmaltag 2016 |
Ein paar Meter von der Steinernen Brücke entfernt, auf der Höhe des Platzes "Am Wiedfang", befindet sich ein kleines gelbes Gebäude, das Ohmwerk, gelegentlich auch Schiffswindenhäuschen genannt.
Es handelt sich um einen elektrisch betriebenen Schiffsdurchzug, der 1914 bis 1964 half, die Schiffe gegen die Strömung durch die Brücke hindurch zu ziehen, und gehört zu den Denkmälern in Regensburg. Er wird auch Treidelschiffsdurchzug genannt.
Es wurde aufgrund einer Privatinitiative restauriert und 2012 "wiedereröffnet".
Was ist ein SchiffsdurchzugSchon ab 1353 gab es solche Schiffsdurchzüge, zunächst auf Stadtamhofer dann auch auf der Regensburger Seite.
In diesem Artikel will ich etwas zur Geschichte erklären und Fotos vom Denkmaltag 2016 zeigen. An diesem Tag konnte man das Ohmwerk innen besichtigen und erhielt eine gut gemachte Führung.
Das TreidelnSchiffe konnten problemlos flussabwärts fahren. Flussaufwärts (bergwärts) musste man "treideln". Das heißt, sie wurden von Menschen oder Pferden vom Ufer aus flussaufwärts gezogen.
![]() |
| Treideln mit Pferden |
![]() |
| Treideln mit Menschen |
![]() |
| Diese Strecke mussten die Treidler in Regensburg überwinden |
Das Problem an der Steinernen BrückeDie im Jahre 1146 vollendete Steinerne Brücke steht auf breiten Pfeiler-Inseln. Das ergab Probleme für das Treideln:
- durch die verminderte Oberfläche fließt dort das Wasser wesentlich schneller als vor und nach der Brücke (Wasser lässt sich nicht wie Luft komprimieren, muss also schneller fließen)
- durch die Stauwirkung ergibt sich ein beträchtlicher Höhenunterschied beim Wasserstand, den die Schiffe überwinden mussten
- nach der Brücke gibt es gefürchtete Wasserströmungen - die Donaustrudel
Die Treidler hatten also bei der Brücke schwer zu kämpfen.
Die Pfeilersockel, auf denen die Steinerne steht, sind extrem breit im Verhältnis zur gesamten Flussbreite - die Stauwirkung ist enorm. Der Höhenunterschied beträgt über einen halben Meter. Gut, um dort Mühlen zu betreiben, schlecht für die Schiffe.
![]() |
| Auszug aus einem Bild aus 1644 (Abriss der Stadt Regensburg) zeigt die Engstellen und die damals auf den Brückenpfeilern stehenden Mühl-Häuschen |
![]() |
| Merians Bild von der Steinernen Brücke zeigt die verengten Stellen und die Mühlen |
Erste Lösung KanalEin Lösungsansatz wäre vielleicht Kanal, der an der Brücke vorbei geht. Tatsächlich wurde der schon von früheren Geschichtsschreibern vermutete Umgehungs-Kanal mittlerweile einigermaßen bestätigt, aber unklar ist immer noch, ob er nicht schon vor dem Brückenbau existierte und ob er nicht auch andere Funktionen hatte.
Der Kanal ging kurz vor der Brücke in die Altstadt und auf der Höhe der Thundorfer Straße wieder in die Donau. Die Kanalmündungen sieht man auf einer alten Karte in der "Schedelschen Chronik", wobei man aber vermutet, dass der "rückfluss" nicht ganz so weit flussabwärts war, wie in diesem Bild.
![]() |
| Regensburg in: Schedelsche Weltchronik, 1493 |
![]() |
| Der obere Kanalzufluss |
![]() |
eine zweite Mündung soll wahrscheinlich den Kanalrückfluss anzeigen,
ist aber nach Ansicht von Fachleuten eher zu weit abwärts angesetzt |
Sicher ist inzwischen nur, dass so eine Art Kanal da war, das ergibt ein Fachartikel von Dr. Lutz-Michael Dallmeier (
http://www.heimatforschung-regensburg.de/2279/1/1107021_DTL1744.pdf).
Rechnen wir aber mal nach: das Wassergefälle im "Umgehungs"-Kanal (wenn er denn wirklich die Umgehungs-Funktion hatte) ist ja zwangsweise dasselbe wie an der Brücke selbst. Die Strömungs-Geschwindigkeit ist etwas geringer, weil es sich das Gefälle über eine größere Strecke hinweg verteilt, aber rechnerisch gesehen macht das nicht viel aus. Außerdem: dass man eine größere Strecke ziehen muss ist auch wieder ein Nachteil.
Also selbst wenn der Kanal diese Funktion hatte, beim Treideln zu helfen -
die optimale Lösung ist das nicht.Außerdem wurde der Kanal im Laufe der Zeit zugeschüttet. Zugeschüttet wurde der anlässlich des Baus des Amberger Salzstadels 1515 bzw. des Regensburger Salzstadels 1620 (der Salzstadel an der Historischen Wurstkuchl).
Spätestens jetzt war eine andere Lösung geboten.
Zweite Lösung SchiffsdurchzugDas Problem mit der Brückenströmung hatte man nicht nur in Regensburg, sondern an allen Flüssen mit Schiffsverkehr. Hier erfand man die Schiffsdurchzüge.
Ein Schiffsdurchzug ist eine Seilwinde, die durch Menschen, Tiere, Dampfloks oder elektrischen Strom betrieben wird.
Diese Lösungen gab es auch in Regensburg, und zwar auf beiden Seiten der Brücke. Also sowohl auf Stadtamhofer Seite (nördlicher Brückenkopf) als auch auf der Regensburger Seite (südlicher Brückenkopf, also ungefähr dort, wo das heutige Ohmwerk ist)
- Nordseite, Stadtamhof: Nach alten Chroniken war am nördlichen Brückenkopf (Stadtamhof) ca 1353 bis 1486 eine große, wohl hölzerne Seilwinde eingesetzt, das sog. Antwerch. Auf der Webseite des Katharinenspitals wird als Anfangsdatum sogar schon das Jahr 1236 oder früher genannt
- Südseite, Regensburg: 1559 wurde oberhalb der Brücke, am Wiedfang, ebenfalls eine hölzerne Winde installiert, das sog. Ohmwerk. Es existiert nicht mehr und man hat auch keine Bilder.
Wir wollen uns nur den Schiffsdurchzug an der Südseite ansehen, etwa dort, wo heute der Wiedfang ist.
![]() |
Ausschnitt aus 1589 Kirchmaier Warhafftige Contrafactur ...
http://regensburg-historisch.blogspot.de/2016/10/1589-warhafftige-contrafactur-teil-1.html |
Dieser 1559 installierte erste Schiffsdurchzug ist
nicht das heute sichbare Ohmwerk. Es wird in vielen Publikationen oft "Ohmwerk" benannt (zur Benennungsproblematik komme ich später noch mal)
Im Jahre 1610 wurde der ersten Schiffsdurchzug in einen neuerrichten Mauerturm verlegt, den man den Ohmturm nannte.
Im Jahre 1849 verschwand der alte Schiffsdurchzug ganz. Der Ohmturm, in dem es sich befand, wurde anlässlich der Umbauten in diesem Bereich abgerissen (
Quelle).
Elektrischer Schiffsdurchzug - das neue Ohmwerk ab 1914Im Laufe der Zeit bekamen viele Schiffe Dampfantrieb, die ein Treideln an der normalen Uferstrecke erübrigten. Aber die hatten nur paar PS und waren zu schwach um das Gefälle an der Steinernen Brücke zu überwinden.
Man überlegte also um 1900 einen maschinell betriebenen Schiffsdurchzug. Während man in anderen Städten auf Pferde oder Dampfmaschinen (bzw., so wie ich das bei der Führung verstanden habe, Dampfloks am Ufer) setzte, plante man in Regensburg um 1900 einen
elektrisch betriebenen Schiffsdurchzug - das bis heute so genante Ohmwerk.
Das war dann praktisch eine elektrisch angetriebene Seilwinde und ein Drahtseil, das über zwei Umlenkrollen am Ufer mit dem Schiff verbunden wurde. Untergebracht wurde es im Gebäude Am Wiedfang 5a.
![]() |
| Das gelbe Haus: das Ohmwerk Regensburg |
![]() |
| Zur Klarstellung: nur das kleine Häuschen ist das Ohmwerk |
1913 erhielt die Firma MAN den Auftrag; Baubeginn war im Februar 1914. Als Antrieb diente ein 550-Volt-Gleichstrommotor von Siemens-Schuckert mit einer Leistung von 50 PS - ein Straßenbahnmotor.
Aber woher soviel Gleichstrom nehmen? Nun, der Strom wurde aus dem Netz der
Regensburger Straßenbahn entnommen, die einige Zeit zuvor eingerichtet wurde.
Die Steuerung
Ein Fenster am Erker ermöglicht einen eingeschränkten Blick auf die Donau, aber wahrscheinlich waren sowieso Helfer draußen, die für den Überblick sorgeten. Ein umgebauter Straßenbahn-Schalthebel diente zum Schalten des Motors.
Die Klappe und die UmlenkrollenDa der Winkel vom Ohmwerk-Gebäude zum Schiff an der gebogenen Uferstelle etwas unglücklich war, arbeitete man mit einem oder zwei Umlenkrollen. Die Verankerungen sollen angeblich noch sichtbar sein.
Außerdem sieht man außen an dem gelben Häuschen noch die hölzerne, blaugrüne Klappe , in der das Seil herauskam. Öffnet man sie, kann man durch eine Glasscheibe in einen dunklen Raum spähen
Siehe dazu auch die interessanten älteren Fotos auf der Webseite des Schiffahrtsmuseums:
http://donau-schiffahrtsmuseum-regensburg.de/index.php?page=12Technische Daten der Winde| Kenngröße | Daten |
|---|
| Inbetriebnahme | 15. Juli 1914 |
| Hersteller | MAN |
| Zugkraft | 5000 kg (50.000 N) |
| Zuggeschwindigkeit | 15 m/min |
| max. Zuglänge | 270 m |
| Seildurchmesser | 22 mm |
| Seiltrommeldurchmesser | 650 mm |
| Antriebsmotor | Hersteller: Siemens-Schuckert
SSW 590428 N Typ GH 250
50 PS bei 850 min−1 |
| Spannung | 500 V Gleichspannung |
| Getriebe | Schneckengetriebe mit Stirnradübersetzung 1:100 |
| Einstellung Regelbetrieb | 17. Januar 1964 |
Wiedereröffnung als
technisches Denkmal | 21. Juli 2012 |
Die Betriebseinstellung im Jahre 1964Die Abhängigkeit vom Straßenbahnstrom führte auch dazu, dass das heutige Ohmwerk 1964 eingestellt wurde.
Denn am 31.7.1964 sollte der Straßenbahnbetrieb in Regensburg beendet werden, der ursprüngliche Stromlieferant somit wegfallen. Inzwischen waren aber die meisten Schiffe mit stärkeren Maschinen ausgestattet. Seit der alte Ludwig- Donau-Main-Kanal durch Kriegsschäden 1944 nur noch in Teilabschnitten befahrbar war, hatte das Ohmwerk sowieso an Bedeutung verloren - es wurde seit den 1950er Jahren kaum noch genutzt.
So stellte man den Betrieb des Ohmwerks im Januar 1964 einstellt - also offenbar noch vor dem Wegfall der Stromversorgung.
Die RestaurierungBei der Führung am Denkmaltag wurde erklärt, dass man europaweit keinen anderen Schiffsdurchzug mehr entdeckt habe, der elektrisch betrieben wurde - es ist also europaweit einmalig.
Trotzdem wurde die Anlage viele Jahre vernachläßigt, die Geräte rosteten vor sich hin. Ab 1985 engagierten sich Freiwillige - der Arbeitskreis Schiffahrtsmuseum Regensburg e.V.. Dieser Verein betreut die (weiterhin im städtischen Eigentum stehende) diesen Treidelschiffsdurchzug.
Ab 2000 war das Ohmwerk optisch soweit hergerichtet, dass es im Rahmen von Führungen wieder gezeigt werden konnte.
Ab 2009 arbeitete der Verein und eine Gruppe der Hochschule Regensburg daran, die Anlage technisch zu reaktivieren - eine interessante Episode, deren Einzelheiten Sie bei einer Führung nachfragen können. Bei dem Tag des offenen Denkmals gab es interessante Gespräche mit Besuchern, die damals mit der Restaurierung zu tun hatten.
Nach aufwändiger technischer Renovierung ist die Schiffswinde seit Juli 2012 wieder funktionsfähig.
Um das zu demonstrieren, wurde eigens ein Schleppkahn hergerichtet und am 21. Juli 2012 durch die Brücke gezogen. Damit bewies der Elektrische Schiffsdurchzug an der Steinernen Brücke offiziell wieder seine Fähigkeit, fast 100 Jahre nach seiner ersten Inbetriebnahme.
Die mysteriöse Name "Ohmwerk"Zu einem Phänomen aber fand ich keine befriedigende Antwort: wieso der Name Ohmwerk.
In der Ausgabe 1849, also Band 13 des
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg fand ich auf Seite 428 folgende Formulierung, die mich stutzig machte:
"In Folge der Bauten für den hiesigen Freihafen wurde der runde Thurm nächst dem kleinen Salzstadel an der steinernen Brücke und die anstoßende Stadtmauer abgebrochen Diesen Thurm ließ nach Gumpelzhaimer's Chronik (Th II S 1044) im Jahre 1610 der Rath zur Aufbewahrung des Zugwerkes der Winden und Seile für die geladenen Schffee so durch die Brücke gezogen werden sollen erbauen. In dessen Nähe befand sich auch (Gumpelhaimer Th II S 1358) das Ohmwerk oder die Am, eine Art Aichanftalt für die Weine von dem Worte Am, ein Maß bei Getränken (s. Westenrieder's Glossarium germanico-latinum S 12). In einer, dem Vereine gehörigen Abbildung der freien Reichsstadt RegenSburg von G: Bahre v. J. 1630 wird dieser Thurm als der Ohmthurm be zeichnet..."
Das macht fast den Eindruck, als ob der Name
Ohmturm vom (nicht damit identischen)
Ohmwerk kommt dessen Name wiederum nichts mit dem Schiffsdurchzug zu tun haben scheint, sondern mit einer
Eichanstalt für Weine.
Wenn diese Annahme wiederum stimmt, dann war die Namensgebung für den elektrischen Schiffsdurchzug etwas missverständlich, wenn nicht verfehlt.
Obwohl vom Autor dieser Zeilen stammend, waren die Überlegungen nicht so verkehrt. Die Fastschon-Lösung fand ich jedenfalls in einem ganz neuen Aufsatz (1999) des historischen Vereins, der im Internet auf der Seite heimatforschung-regensburg.de in vollem Wortlaut abrufbar ist
- Die Befestigung der Reichsstadt Regensburg und ihr Wandel bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Von Helmut-Eberhard Paulus, 1999
Dort heißt es auf Seite 56 unten:
"Kurz vor dem Windenhäuschen mit dem Ohmwerk (Am Wiedfang 5 a) befand
sich das Ohmtürlein. Ohmtürlein und Ohmwerk sind nach dem ehemaligen Ohmturm
benannt, der sich unmittelbar westlich des Amberger Salzstadels erhob. Er
wurde 1610 von Grund auf neu errichtet. Der Name Ohm rührt von der ehemaligen,
in unmittelbarer Nähe am Wiedfang befindlichen Salzohm her, wo das Wiegen
und Eichen der Salzfässer stattfand. Der Name ist vom mittelhochdeutschen Wort
„Ome" abgeleitet, das soviel wie „Maß" bedeutet."
Und weiter heißt es:
"Der Name „Ohm" wurde auch auf die Umgebung des Wiedfangs bezogen und so schließlich auf die Schiffswinde, mit der die Boote stromaufwärts über die Strudel und durch die Brücke gezogen wur-den. Seit 1914 wurde das Ohmwerk elektrisch betrieben. Aus dieser Zeit stammt auch das Windenhäuschen mit seinem auf die Donau ausgerichteten Beobachtungserker ... "
(Zitat aus: Die Befestigung der Reichsstadt Regensburg und ihr Wandel bis zum Ende des 19. Jahrhunderts von Helmut-Eberhard Paulus, 1999)
Also eine Namensverfärbung, speziell in Regensburg. Womit klar ist, warum ich sonst in Deutschland nirgends eine Verbindung Schiffsdurchzug und Ohmwerk fand.
Aber: Damit scheint es mir aber immer noch so zu sein, dass in wissenschaftlichen wie auch in allgemeinen Ausführungen die Begriffe durcheinander gebracht werden. Denn gemäß dem o.g. älteren Aufsatz aus 1849 verstand man unter dem OHMWERK eben nicht die Schiffswinde, die sich im Ohmturm befand, sondern die benachbarte Eichanstalt.
Das deutet darauf hin, dass erst mit dem neuen (elektrischen) Schiffsdurchzug die Namen verwechselt wurden - vielleicht auch absichtlich, wer weiß. Aber vorher hatte man unter dem Namen Ohmwerk eine andere Vorstellung als die Schiffswinde.
![]() |
| Auszug aus VHVO Band 13 (1849) |
Man sollte in in Aufsätzen über den
früheren Schiffsdurchzug vielleicht besser nicht mehr vom
Ohmwerk sprechen.
- 1559 - 1849 Erster Schiffsdurchzug (ab 1610 im Ohmturm)
- 1914 - 1964 Zweiter Schiffsdurchzug (Ohmwerk genannt)
Besichtigung des Ohmwerks
Links: